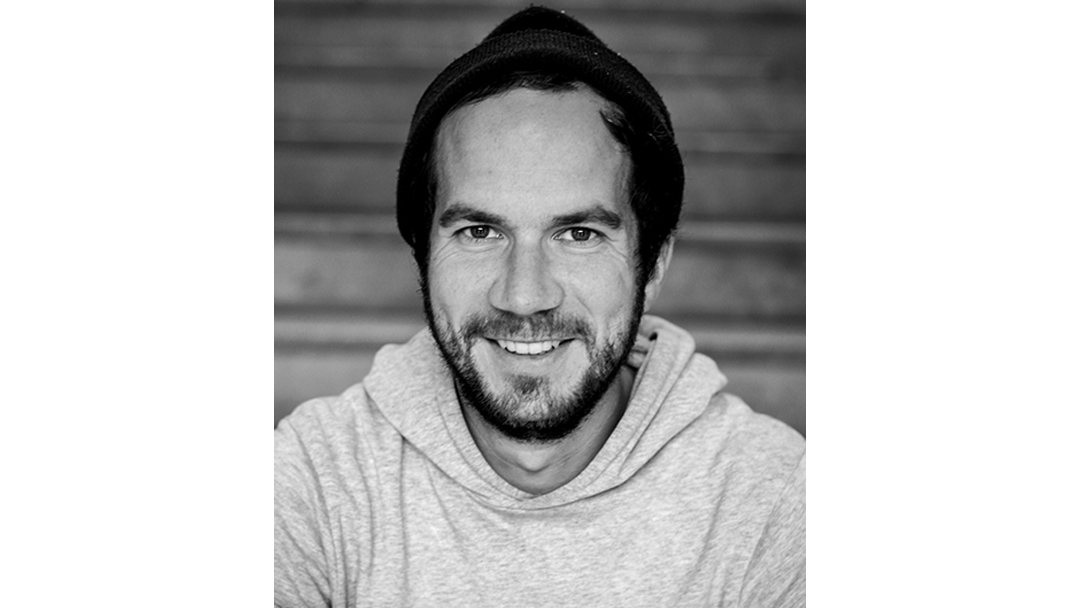Frage: Warum müssen sich Unternehmen in den letzten Jahren immer stärker mit digitaler Ethik oder der Wahrnehmung ihrer digitalen Verantwortung beschäftigen?
Einerseits, weil digitale Technologien Eingang in immer mehr Unternehmensbereiche finden. In den letzten Jahren waren vor allem Themen wie virtuelle Zusammenarbeit und datengetriebene Entscheidungen maßgeblich dafür verantwortlich, dass es heute immer weniger nicht-digitale Arbeitsplätze und Tätigkeitsbereiche gibt. Doch nicht nur digitale Technologie ist ausschlaggebend, sondern auch ein immer häufiger beschworenes „Digital Mindset“ in Unternehmen. Dabei darf aber nicht das technisch Machbare ausschlaggebend sein, sondern vor allem Fragen nach betriebswirtschaftlich und gesellschaftlich nachhaltigen Lösungen im Vordergrund stehen.
Andererseits müssen sich Entscheidungsträgerinnen und -träger in Unternehmen aber auch darauf einstellen, dass Ihre Stakeholder zunehmend Fragen nach der digitalen Unternehmensverantwortung stellen. Das gilt nicht nur für Kundinnen und Kunden, sondern auch Investorinnen und Investoren wollen wissen, wie ihr Geld angelegt ist. Zunehmend ist auch für junge, digital gut ausgebildete Fachkräfte wichtig, dass die Organisationen, in denen sie zukünftig arbeiten, sich durch verantwortungsvolles Handeln in einer digitalen Welt auszeichnen.
Frage: Wo liegen die größten Herausforderungen auf dem Gebiet der digitalen Verantwortung?
Das finden geeigneter ethischer Maßstäbe und Grundsätze ist für viele sehr anstrengend. Leider ist es nicht so, dass wir hier auf eine tausende Jahre alte Tradition zurückgreifen können. Viele Herausforderungen, mit denen wir uns heute konfrontiert sehen, müssen zumindest neu durchdacht und entsprechende Leitlinien erst entwickelt werden. Solche Leitlinien lassen sich nirgendwo runterladen, sondern müssen in oft sehr intensiver Arbeit mit allen relevanten Anspruchsgruppen erarbeitet werden.
Und wenn entsprechende Leitlinien erst mal etabliert sind, müssen diese immer noch im Unternehmen umgesetzt werden. Fortschritte beim Thema CSR allgemein bereiten da sicher einen fruchtbaren Boden, doch die in der Breite oft noch nicht entwickelten digitalen Fähigkeiten führen oft noch zu Missverständnissen und Berührungsängsten. Das müssen Führungskräfte mit viel Energie und Feingefühl angehen, wenn digitale Unternehmensverantwortung nachhaltig Fuß fassen soll.
Frage: Welche Maßstäbe stehen den Unternehmen zur Beurteilung ihrer digitalen Verantwortung zur Verfügung?
Auch wenn die Zahl und der Detailgrad von entsprechenden Bezugsrahmen in den letzten beiden Jahren enorm gewachsen ist, eine universelle Antwort gibt es hier (noch) nicht. Auch hier ist der Austausch mit den Anspruchsgruppen zentral – im Unternehmen und darüber hinaus. Das gilt gleicher Maßen für die Inhalte (also: Welche Werte sind und im Kontext der digitalen Unternehmensverantwortung besonders wichtig?) als auch für die Umsetzung (also: Wie drückt es sich in unserem täglichen Handeln aus, dass wir einen speziellen Wert für wichtig erachten?). Für mich ist die Erklärbarkeit des eigenen und unternehmerischen Handelns dabei wichtig, denn nur so können sich relevante Anspruchsgruppen ein Bild machen, wie ernst es mir mit dem Thema der digitalen Unternehmensverantwortung ist.
Prof. Dr. Benjamin Müller war Referent im Workshop Corporate Digital Responsibility in der Kommunikation